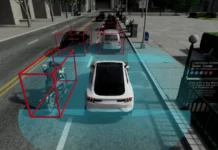Plug-in-Hybride erleben derzeit eine starke Nachfrage. Der Hintergrund: Ab 2026 gelten neue Regeln zur CO₂-Berechnung, die sich auf die Flottenstrategie vieler Unternehmen und auf die Bewertung der Fahrzeuge auswirken. Bereits im September erreichte der Anteil von Plug-in-Hybriden an den Neuzulassungen in Deutschland fast 12 Prozent und nähert sich damit dem Niveau von Dieselfahrzeugen, berichtet die Automobilwoche.
Vor allem im Flottenmarkt sorgen die Rahmenbedingungen für eine verstärkte Nachfrage zum Jahresende. Benjamin Kibies, Analyst beim Marktforschungsunternehmen Dataforce, sieht hier die größte Dynamik: „Für das letzte Quartal rechne ich nochmals mit einer kleinen Jahresendrallye.“ Er prognostiziert von September bis Dezember rund 44.000 Neuzulassungen bei Plug-in-Hybriden.
Der erwartete Rückgang im Folgejahr fällt laut Kibies vergleichsweise gering aus. Zwar soll die Zahl der Neuzulassungen 2026 auf etwa 130.000 Fahrzeuge sinken, das wären rund 13.000 weniger als im Vorjahr. Kibies sieht aber keinen dramatischen Einbruch.
Im Vergleich zum Rückgang nach dem Ende der staatlichen Stromer-Kaufprämie vor drei Jahren fällt die prognostizierte Entwicklung harmlos aus: 2022 wurden noch über 362.000 Plug-in-Hybride neu zugelassen, 2023 nur noch rund 176.000. Seither steigt die Zahl wieder kontinuierlich. Im August 2025 überschritt der Anteil im Flottenmarkt erstmals seit Ende der BAFA-Förderung wieder die Marke von 17 Prozent.
Kibies erwartet für das vierte Quartal 2025 einen weiteren Anstieg des Marktanteils auf 19,6 Prozent – ein deutliches Plus gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 16,7 Prozent. Damit zeigt sich der Plug-in-Hybrid-Antrieb als weiterhin gefragte Technologie, besonders im gewerblichen Bereich.
Änderung der CO₂-Berechnung durch die EU
Ein entscheidender Faktor für die aktuelle Nachfrage dürfte die bevorstehende Änderung der CO₂-Berechnung durch die EU sein. Seit Anfang 2025 gilt die neue Methodik zunächst für neue Fahrzeugtypen, ab Anfang 2026 dann für alle neu zugelassenen Plug-in-Hybride. Diese Umstellung führt zu deutlich höheren CO₂-Werten, mit praktischen Konsequenzen für Flottenbetreiber.
So zeigt sich etwa in der Mittelklasse ein klarer Unterschied, erläutert die Automobilwoche. Der nach neuer Norm erfasste Audi A5 Plug-in weist demnach einen CO₂-Ausstoß von 58 g/km auf, während der BMW 3er und die Mercedes C-Klasse nach alter Norm lediglich 23 beziehungsweise 24 g/km angeben. Ab 2026 werden sich diese Werte entsprechend angleichen – und teilweise verdoppeln.
Trotz dieser Entwicklung dürften Plug-in-Hybride für viele Hersteller ein wichtiger Baustein ihrer Elektrostrategie bleiben, sagt Marktexperte Kibies. Reine Elektroautos fänden noch nicht in dem erhofften Maß Anklang bei den Kunden.
Für viele Dienstwagenfahrer bleibt auch die steuerliche Behandlung von Plug-in-Hybriden ein Schlüsselkriterium. Teilzeitstromer mit einer elektrischen Reichweite über 80 Kilometern profitieren weiterhin von einer halbierten Dienstwagensteuer, nur 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises werden pro Monat fällig. Diese Regelung sorgt weiterhin für Kaufanreize im Geschäftskundenbereich.
Automobile Magazine-Germany