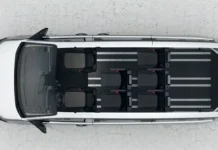Michael Halbherr, Chef des Ladeinfrastruktur-Herstellers ABB E-mobility, sieht in der Diskussion um ein mögliches Ende des geplanten EU-„Verbrenner-Verbots“ eine erhebliche Gefahr für die Industrie. In einem Interview mit Merkur.de kritisiert er vor allem die mangelnde Verlässlichkeit politischer Entscheidungen.
„Dieses Hü-Hott, das wir gerade erleben, ist das Schlimmste, was der Industrie passieren kann“, so Halbherr. Unternehmen müssten sich darauf verlassen können, dass politische Rahmenbedingungen und Förderungen eine gewisse Beständigkeit haben. Wenn Subventionen plötzlich gekürzt würden, könne das schwerwiegende Folgen haben. Besonders in Deutschland fehle Politikern häufig die praktische Wirtschaftserfahrung, die nötig wäre, um planbare Vorgaben zu schaffen.
Als positives Beispiel nennt Halbherr die USA: Dort sei es gelungen, durch klare staatliche Rahmenbedingungen private Investoren und Unternehmen zu Mega-Projekten wie privaten Raumfahrtprogrammen zu befähigen. In Europa hingegen änderten sich die Vorgaben regelmäßig, oft nach Wahlen, was Innovation und Investitionen bremse.
Halbherr spricht sich für Technologieoffenheit aus, sieht aber im Elektroauto klare Vorteile. Während Verbrenner nur etwa 30 Prozent Energieeffizienz erreichten, lägen E-Autos bei über 80 Prozent. „Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das E-Auto besser ist als der Verbrenner, deshalb wird es sich auf lange Sicht durchsetzen“, so der ABB-Manager. Verbote seien selten hilfreich, vielmehr müsse die Politik faire Rahmenbedingungen für Technologien schaffen.
Besorgt zeigt sich Halbherr über die aktuelle öffentliche Debatte, die seiner Meinung nach die Elektromobilität kleinredet. Während nach der Corona-Pandemie die Technologie überschätzt worden sei, werde sie heute unterschätzt. Tatsächlich habe sich die Ladeinfrastruktur stabilisiert und sei zu einem rentablen Geschäft geworden. Die Fortschritte bei Batterien, Ladegeschwindigkeit und Netztechnik würden weiter anhalten.
Passende Ladeinfrastruktur und genügend Energie wichtig
Ein zentrales Thema sieht Halbherr in der Anpassung der Ladeinfrastruktur an den Alltag der Nutzer. Ladeangebote müssten auf den jeweiligen Standort zugeschnitten sein. So könne etwa ein Einkaufszentrum mit vergleichsweise günstigen 50-Kilowatt-Ladestationen ausgerüstet werden, da die Ladezeit während des Einkaufs ohnehin kaum ins Gewicht falle.
Darüber hinaus warnt der Manager vor Engpässen bei der Energieversorgung. Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Bussen, Lkw und Schwertransportern werde der Bedarf massiv steigen. Es müsse gewährleistet sein, dass genügend günstige und zuverlässige Energie verfügbar sei – auch in Zeiten, in denen erneuerbare Energien nicht ausreichend einspeisen.
Ein weiteres Hindernis für die Entwicklung der Elektromobilität sieht Halbherr in der deutschen Bürokratie. Als Beispiel nennt er den Austausch eines gestohlenen Kabels an einer Ladestation: Selbst in diesem Fall sei eine komplette Neueichung erforderlich, was zu monatelangen Stillständen führen könne. Auch Genehmigungsverfahren dauerten hierzulande deutlich zu lange.
Halbherr fordert, stärker auf die wirtschaftlichen Grundlagen der Elektromobilität zu achten. Anfangs sei man von der Technologie begeistert gewesen und habe alles elektrifizieren wollen, ohne die ökonomischen Rahmenbedingungen ausreichend zu berücksichtigen. Entscheidend sei, dass sich die Branche auch als Geschäft behaupten könne.
Abschließend kritisiert Halbherr die deutsche Mentalität, die seiner Meinung nach zu sehr auf Verbote und gesetzliche Regelungen setzt. Während andere Regionen der Welt neue Technologien aktiv vorantrieben, dominiere hierzulande Skepsis. Stattdessen müsse man Chancen erkennen und Technologien, ob neu oder etabliert, als Teil des Fortschritts begreifen.
Germany